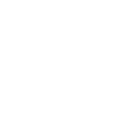Fotografie: AA+W
Fotografie: AA+W
Wasserstoff: Energieträger mit Potenzial – aber nicht um jeden Preis
Bei der Herstellung von erneuerbaren Energieträgern nimmt Wasserstoff eine Schlüsselrolle ein. Ob er allerdings als reiner Wasserstoff oder in Form von daraus hergestellten Derivaten wie Methanol oder Ammoniak breite Anwendung finden wird, ist derzeit offen. Diese Frage ist zentral, um zu entscheiden, ob die Schweiz in eine umfassende Wasserstoffinfrastruktur investieren soll. Entscheidend ist neben der Verfügbarkeit und auch der Preis: Es ist davon auszugehen, dass erneuerbare Energieträger auch langfristig mindestens doppelt so teuer bleiben wie fossile Energieträger.
Die Nachfrage bleibt begrenzt
Die Nachfrage nach Wasserstoff in der Schweiz dürfte eingeschränkt bleiben. Hauptabnehmer für erneuerbare Energieträger werden der Flugverkehr, die Schifffahrt, einzelne industrielle Prozesse sowie Teile des Schwerverkehrs. Ob hier allerdings Wasserstoff oder ein Derivat zum Einsatz kommen wird, ist heute noch offen.
Gleichzeitig stehen dem Einsatz von Wasserstoff günstigere und effizientere Alternativen – insbesondere die direkte Elektrifizierung – gegenüber. Diese werden sich voraussichtlich in den meisten Anwendungen durchsetzen. Um die ansässige Industrie zu erhalten, sollte die Schweiz gezielt in Forschung zur Elektrifizierung von Prozesswärme investieren – einem Bereich mit grossem Potenzial.
Infrastruktur: Selektive Anbindung statt flächendeckendem Ausbau
Auf den Aufbau eines flächendeckenden Wasserstoffnetzes soll deshalb verzichtet werden. Stattdessen sollte die Schweiz ihre Infrastruktur gezielt an ein zukünftiges europäisches Wasserstoffnetz anschliessen und zentrale Verbraucher an diesem Ort konzentrieren. So können spezialisierte Anwendungen bedient werden, ohne überdimensionierte und kostspielige Infrastrukturen zu schaffen. Parallel dazu können lokale Produktionsstätten können interessant sein, sollen aber vor allem lokale Bedürfnisse befriedigen oder den heute verwendeten, grauen Wasserstoff durch grünen Wasserstoff ersetzen. Diese Produktion darf nicht durch Regulierungen behindert werden.
Import statt Eigenproduktion
Die Schweiz wird erneuerbare Energieträger eher wie bisher Erdöl – jedoch in deutlich geringerem Mass – importieren. Technische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen sprechen für einen Import, vor allem aus Regionen mit günstigen Produktionsbedingungen wie Patagonien, Südafrika, Oman oder Australien. Vor allem über lange Distanzen insbesondere zwischen Kontinenten sind hier wiederum Derivate im Vorteil.
Strom, CO₂ und Forschung: Wo die Schweiz investieren sollte
Die Schweiz wird in den kommenden Jahrzehnten massiv in drei Infrastrukturen investieren müssen: In den Ausbau der erneuerbaren Energien, in die Verteilung von Strom, sowie in den CO₂-Transport und die Entsorgung von unvermeidbaren CO2-Emissionen. Das limitiert die Finanzmittel für eine Wasserstoffinfrastruktur zusätzlich.
Fazit: Wasserstoff ja – aber mit Augenmass
Die Energiewende braucht Lösungen. Wasserstoff kann eine davon sein – aber nicht in der Breite. Für die Schweiz ergibt sich ein klares Bild: Konzentration auf wenige, Anwendungen, intelligente internationale Vernetzung und der Fokus auf Alternativen wie die Elektrifizierung und die Anwendung von leichter zu handhabenden Derivaten sind der Weg der Wahl. Diese Vision ist nicht weniger ambitioniert – aber deutlich realistischer.
Die Aussagen dieses Beitrags und des Thesenpapiers widerspiegeln nicht die Haltung sämtlicher Mitglieder – sie wurden aber auf Basis einer Vielzahl von Gesprächen mit Anspruchsgruppen – darunter viele Mitglieder – erarbeitet. Die Aussagen entsprechen unserem Wissensstand vom 12. Mai 2025.