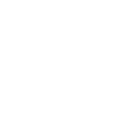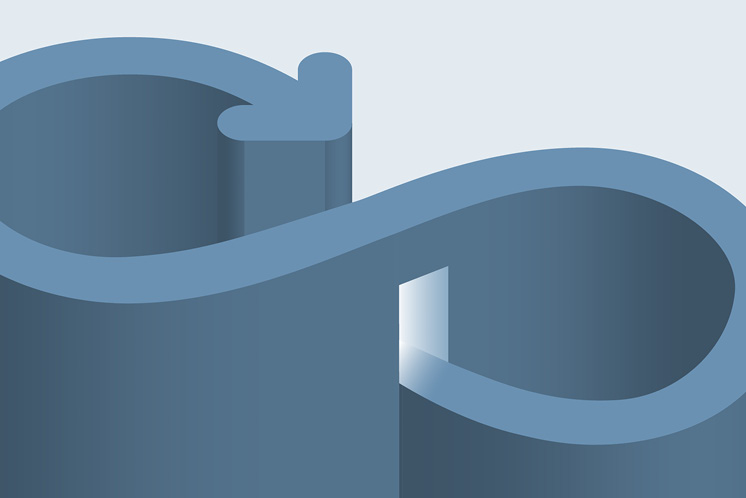
Die Revision des Umweltschutzgesetzes (USG) stellt die Weichen für eine ressourcenschonendere und wettbewerbsfähigere Wirtschaft in der Schweiz. Die Anpassung der rechtlichen Grundlagen ist ein notwendiger Schritt, um auf globale Herausforderungen wie Rohstoffknappheit, Umweltbelastung und steigende regulatorische Anforderungen zu reagieren. Doch die Revision allein genügt nicht – der Erfolg entscheidet sich in der Umsetzung.
Neue Möglichkeiten, aber auch Unsicherheiten
Das revidierte USG gibt Bund, Kantonen und Gemeinden neue Instrumente an die Hand, um Kreislaufwirtschaft gezielt zu fördern. Unternehmen erhalten Anreize, Ressourcen effizienter zu nutzen, Produkte langlebiger zu gestalten und Wertstoffe vermehrt im Kreislauf zu halten. Vor allem der erfolgversprechende Mechanismus der Branchenlösung wurde gezielt gestärkt. Doch gewisse Neuerungen sind nur als «Kann»-Formulierungen beschlossen worden. Diese gesetzliche Flexibilität bezüglich der tatsächlichen Umsetzung durch den Bund schürt bei Unternehmen Unsicherheiten.
Umsetzung als entscheidender Faktor
Damit die Revision ihre Wirkung entfaltet, braucht es entschlossenes Handeln auf allen Ebenen:
- Der Bund muss konkrete und verbindliche Verordnungen priorisieren sowie praxisnahe Vollzugshilfen bereitstellen, die insbesondere die Reparierbarkeit, Langlebigkeit und stoffliche Verwertbarkeit von Produkten regeln.
- Kantone und Gemeinden sind gefordert, ihre neuen Kompetenzen aktiv zu nutzen.
- Unternehmen benötigen Planbarkeit, finanzielle Anreize und Möglichkeiten für effektiven Austausch und Wissenstransfer.
Abstimmung mit der EU
Die Schweiz steht in enger wirtschaftlicher Verflechtung mit der EU, die bei Standards zur Kreislaufwirtschaft voranschreitet. Schweizer Unternehmen riskieren Wettbewerbsnachteile, wenn die regulatorischen Entwicklungen nicht koordiniert werden. Eine frühzeitige Angleichung an EU-Normen bei Produktdesign, Reparierbarkeit und Materialeffizienz ist unerlässlich.
Unternehmen im Wandel begleiten
Besonders KMU stehen vor Herausforderungen: Investitionskosten, fehlendes Know-how und unsichere Marktchancen bremsen oft den Wandel. Politik und Verbände müssen diesen Transformationsprozess aktiv unterstützen:
- Finanzielle Fördermassnahmen und steuerliche Anreizmechanismen schaffen Investitionssicherheit.
- Gestärkte branchenspezifische Plattformen helfen, Lösungen zu entwickeln.
- Bildungsmassnahmen stellen sicher, dass die benötigten Fachkräfte bereitstehen und die Transformation vorantreiben können.
Die Rolle der öffentlichen Hand
Bund, Kantone und Gemeinden haben nicht nur Steuerungskompetenzen, sondern auch eine Marktmacht durch ihre Beschaffung. Wenn sie kreislauffähige Produkte bevorzugen, schaffen sie Nachfrage und stabilisieren den Markt für innovative Lösungen. Hier hat die Revision des BöB (Bundesgesetz über die öffentliche Beschaffung) 2019 die Grundlage dafür gelegt, dass für den Zuschlag nicht mehr nur der Preis, sondern auch Aspekte wie die Nachhaltigkeit ausschlaggebend sind.
Fortschritte messen
Der Wandel zur Kreislaufwirtschaft ist ein Prozess, der Transparenz und Monitoring erfordert. Voraussetzung ist eine solide Datenbasis zu Stoffströmen und Unternehmensaktivitäten, um Fortschritte sichtbar zu machen und so gegebenenfalls nachsteuern zu können.
Der Weg nach vorne
Die USG-Revision bietet die Chance, die Schweiz als Vorreiterin der Kreislaufwirtschaft zu positionieren. Der Erfolg hängt jedoch von der konsequenten Umsetzung und der engen Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ab. Jetzt gilt es, diese Chance zu nutzen.